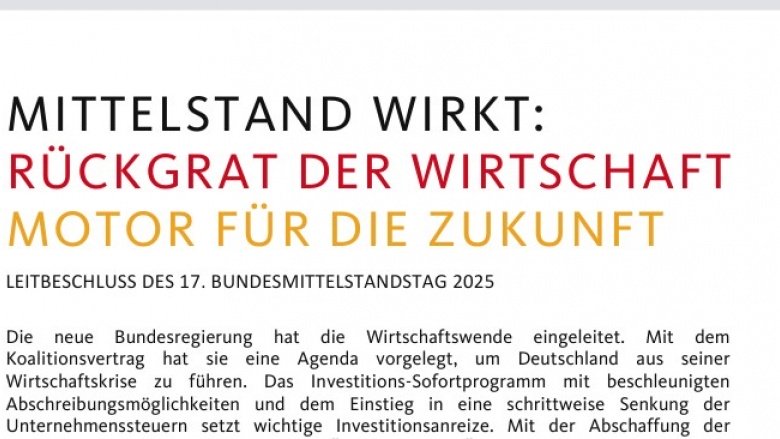
Die Wirtschaftswende steht aber erst am Anfang. Deutschland muss endlich seine strukturellen Wachstumsprobleme angehen und den Reformstau auflösen. Alle politischen Entscheidungen müssen sich daran messen lassen, ob sie die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit am Standort verbessern und so zu einer höheren Wachstumsdynamik beitragen. Unser Land braucht eine echte Reformagenda, um den Standort Deutschlands zu sichern.
Deutschland muss die Stärke seines Mittelstands bewahren – er ist Rückgrat der Wirtschaft und Motor für die Zukunft zugleich.
Wir fordern:
Mit öffentlichem Geld verantwortungsbewusst umgehen: Ausgaben priorisieren, Investitionen hebeln, Unternehmen entlasten
- Die Nutzung der Mittel des Sondervermögen Infrastruktur muss ordnungspolitisch effizient erfolgen und transparent nachvollziehbar sein. Das erfordert eine ganzheitliche wirtschaftliche Betrachtung und die Anwendung klarer Governance-Regeln. Die Mittel dürfen nur zusätzlich und investiv für wachstumswirksame Investitionen (z.B. Energie- und Verkehrsinfrastruktur, Digitalisierung) verwendet werden und müssen die Mobilisierung privaten Kapitels mit geeigneten Finanzierungsinstrumenten nach sich ziehen.
- Die gezielte staatliche Förderung von Forschung und Innovation ist eine effektive Form der Industriepolitik. Die F&E-Ausgaben müssen in die Zukunft orientiert sein und dabei die für Deutschland relevanten Schlüsseltechnologien adressieren. Forschungsförderung muss technologieoffen ausgestaltet sein. Mittelstandsorientierte Programme wie das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) sowie die industrielle Gemeinschaftsforschung müssen ausgebaut werden.
- Wir fordern eine Obergrenze für die Staatsquote in Höhe von 45 % gemessen am BIP. Die Einhaltung dieser Obergrenze ist zu erreichen durch tiefgreifende Strukturreformen in den Bereichen Sozialstaat, Sozialversicherungen, Verwaltung und Subventionswesen. Auf neue dauerhafte Sozialleistungen muss verzichtet werden.
- Die Bundesregierung muss kontinuierlich überprüfen, ob die im Koalitionsvertrag beschlossenen Maßnahmen zur steuerlichen Entlastung von Unternehmen vorgezogen werden können. Auch die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags muss weiterhin das Ziel sein. Steuererhöhungen sowie zusätzliche Steuern und Abgaben lehnen wir ab. Für die Breite des Mittelstands ist die Einkommensteuer zugleich die Unternehmensteuer. Eine Tarifreform in der Einkommensteuer darf nicht dazu führen, dass Personenunternehmen stärker belastet werden.
- Um die öffentlichen Haushalte zu entlasten, müssen Zukunftsaufgaben stärker durch private Investitionen finanziert werden. Institutionelle Anleger sollen sich durch verbesserte Rahmenbedingungen stärker als bisher an Wachstumsunternehmen beteiligen können, Börsengänge müssen einfacher, die steuerliche Rahmenbedingungen für Wertpapieranlagen besser werden.
- Auch im Zuge einer möglichen Reform muss die Schuldenbremse im Kern bestehen bleiben. Um die Tragfähigkeit deutscher Schulden auch in Zukunft sicherstellen zu können, dürfen die Regeln nicht weiter aufgeweicht werden. Sichtbar gewordene Gestaltungslücken zur Umgehung der Schuldenbremse müssen geschlossen werden.
Auf Freiheit und Vertrauen setzen: Bürokratie abbauen und Flexibilität für unsere Betriebe schaffen
- Im Rahmen des Bekenntnisses zu einer digitalen Verwaltung müssen antragslose digitale Verfahren und das „Once-Only“-Prinzip eingeführt werden: Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen sollen ihre Daten gegenüber dem Staat nur einmal angeben müssen.
- Wir müssen Genehmigungsverfahren konsequent vereinfachen sowie das Verbandsklagerecht reformieren und einschränken.
- Das nationale Lieferkettenpflichtensorgfaltsgesetz und die EU-Lieferkettenrichtlinie müssen sofort abgeschafft werden.
- Alle Bundesministerien sollen aufgefordert werden, weitere konkrete bürokratische Hürden zu benennen, die temporär ausgesetzt oder direkt abgeschafft werden können.
- Auch auf EU-Ebene müssen bürokratische Lasten konsequent abgebaut werden. Die Anzahl der delegierten Rechtsakte aus dem Green Deal muss konsequent sinken. Deutschland muss die 1:1-Umsetzung europäischer Anliegen strikt anwenden. Dort, wo EU-Vorgaben schon übererfüllt wurden (wie z. B. bei der DSGVO), soll eine Reduzierung auf das EU-weit geltende Minimum erfolgen. Das Energieeffizienzgesetz und das Gebäudeenergiegesetz müssen auf das europäische Minimum angepasst werden. Die Umsetzung von EU-Recht und Einmalaufwendungen sollten endlich in der als Bürokratiebremse konzipierten „One-in-one-out“-Regelung einbezogen werden. Anschließend ist die Regelung in „One-in-two-out“ zu erweitern.
- Gründungen müssen durch Gründerschutzzonen, Reallabore und die vereinfachte Gründung innerhalb von 24 Stunden als „One-Stop-Shop“ erleichtert werden.
- Neue Berichts-, Statistik- und Meldepflichten, die nicht digital zu erfüllen sind und nicht mit dem „Once-Only“-Prinzip vereinbar sind, dürfen nicht mehr beschlossen werden (Belastungsmoratorium).
Arbeitswelt und Sozialsystem neugestalten: Leistungsanreize stärken, Fachkräfte gewinnen, Gesundheitsversorgung und Altersvorsorge zukunftssicher machen
- Die Soziale Marktwirtschaft verbindet die Freiheit des Marktes mit einem sozialen Ausgleich. Im Rahmen des sozialen Ausgleichs ist festzulegen, wer welche sozialen Leistungen wirklich braucht und wer nicht. Der Sozialstaat ist umfassend zu reformieren.
- Mit der Aktivrente sollen Rentner, die über das gesetzliche Rentenalter hinaus arbeiten, bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei hinzuverdienen können – jedoch ohne Anreiz zur Frühverrentung.
- Das Bürgergeld soll zu einer aktivierenden Grundsicherung mit klaren Rechten und Pflichten umgebaut werden. Schnelle Vermittlung in Arbeit muss wieder Vorrang haben. Eine Sozialstaatsreform muss Leistungen bündeln und Anreize setzen, durch zusätzliche Erwerbsarbeit ein höheres Einkommen zu erzielen.
- Eine zentrale Agentur soll die Einwanderung qualifizierter Fach- und Arbeitskräfte effizienter steuern („Work-and-stay“). Anerkennungs- und Verwaltungsverfahren müssen beschleunigt, Zuständigkeiten klarer geregelt werden. Das Beschäftigungsverbot für Zeitarbeit aus Drittstaaten muss entfallen und das sektorale Verbot der Zeitarbeit im Bauhauptgewerbe aufgehoben werden.
- Für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf müssen gesetzliche Grundlagen für Vertrauensarbeitszeit und eine wöchentliche statt einer werktäglichen Höchstarbeitszeit geschaffen werden, inklusive Öffnungsklauseln für Ruhezeiten.
- Selbständigkeit ist ein zentraler Bestandteil unserer Wirtschaft und muss gestärkt werden. Die Abgrenzung zwischen Selbstständigkeit und Scheinselbstständigkeit soll planbarer und transparenter werden. Eine Genehmigungsfiktion sowie eine unabhängige Prüfstelle sollen für ein objektives Prüfverfahren und mehr Rechtssicherheit sorgen. Rückwirkende Beitragspflichten bei gutgläubigem Verhalten sollen entfallen. Für selbständige Schwangere und Mütter müssen bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden.
- Die Frühstart-Rente muss mutiger gedacht werden – durch die Möglichkeit privater Einzahlungen und im Zusammenhang mit einer Riester-Reform. Die gesetzliche Rente muss demografiefest gemacht werden, wobei Nachhaltigkeit, Generationengerechtigkeit und die Stärkung kapitalgedeckter Säulen zentrale Ziele sind. Deshalb lehnen wir die weitere Aussetzung des Nachhaltigkeitsfaktors bis 2031 ab. Die Rentenkommission muss das Gesamtsystem überprüfen.
- Langfristig müssen wir uns bei den Sozialversicherungsbeiträgen wieder auf die 40 Prozent hinbewegen. Die Beitragssätze in der Kranken- und Pflegeversicherung müssen durch tiefgreifende strukturelle Reformen stabilisiert und in einem ersten Schritt die Systeme von den versicherungsfremden Leistungen entlastet werden. Eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen muss unterbleiben. Die Krankheitslast soll durch Maßnahmen der Prävention dauerhaft reduziert werden.
- Mittelständische wie industrielle Gesundheitswirtschaft müssen durch verbesserte Rahmenbedingungen für Entwicklung und Produktion gezielt gestärkt werden. Die Versorgungssicherheit und eine verbesserte Krisenresilienz sollen durch die Rückverlagerung von Produktionsstandorten für kritische Wirkstoffe und Arzneimittel sowie Medizinprodukte nach Deutschland und Europa gesichert werden.
Energiepolitik marktwirtschaftlich ausrichten: Bezahlbarkeit herstellen, Versorgungssicherheit gewährleisten und Klimaneutralität erreichen
- Die Energiepreissenkungen sollten sofort umgesetzt werden. Die im Koalitionsvertrag zugesagte Absenkung der Stromsteuer für alle Verbrauchergruppen auf das europäische Mindestniveau sollte schnellstmöglich kommen. Alle Maßnahmen sollten schnell, unbürokratisch und dauerhaft umgesetzt werden. Der Mittelstand braucht Planungssicherheit statt politischer Hängepartien. Um die Energiekosten dauerhaft auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau zu senken, muss vor allem das Energieangebot technologieoffen erhöht werden. Das gilt auch für die zivile Nutzung der Kernkraft bei Anlagen der vierten und fünften Genration.
- Die Systemkosten in der Energiepolitik müssen konsequent gesenkt werden. Die einseitige Fokussierung der bisherigen Energiepolitik auf Wind und Sonne, ohne Rücksicht auf Netzstabilität und Speicher, hat die Systemkosten explodieren lassen – zu Lasten von Mittelstand, Handwerk und Industrie. Die MIT fordert eine Rückbesinnung auf die drei energiepolitischen Kernziele: Bezahlbarkeit, Versorgungssicherheit und Klimaneutralität. Diese Ziele müssen gleichrangig behandelt und nicht gegeneinander ausgespielt werden.
- Wir müssen konsequent auf Technologieoffenheit setzen. Wer Innovationen will, muss Vielfalt zulassen. Der Staat darf nicht entscheiden, welche Technologie sich durchsetzt. Neben Wind und Sonne gehören auch Biomethan, Geothermie, Wasserkraft, Speicher, Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe sowie neue Kerntechnologien zur Lösung. Auch die CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS) muss schnell vorangebracht werden. Wir brauchen keine Denkverbote bei der Energiezukunft Deutschlands.
- Wir brauchen eine Molekülwende. 80 Prozent unseres Endenergieverbrauchs beruhen heute auf molekularen Energieträgern. Für viele mittelständische Unternehmen – insbesondere im produzierenden Gewerbe – ist Elektrifizierung keine kurzfristige Option, bevor der Netzausbau nicht die notwendige quantitative, sichere und insbesondere kontinuierliche Leistung gewährleistet. Wasserstoff, Biomasse, E-Fuels und Gas werden auch in Zukunft gebraucht, um Arbeitsplätze und Wertschöpfung zu sichern und Klimaneutralität zu erreichen.
- Wir müssen mehr strategische Energiepartnerschaften schließen, um die Versorgung zu sichern. Der russische Angriffskrieg hat gezeigt: Energiepolitik ist Geopolitik. Die Bundesregierung muss aktiv neue globale Energiepartnerschaften eingehen. Diversifizierung macht Deutschland resilient und sichert bezahlbare Energie auch in Krisenzeiten.

Empfehlen Sie uns!